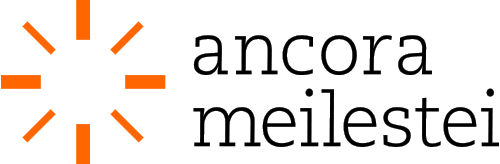Warum die ersten Christen nicht «in die Gemeinde» gingen
Ich warte auf den Tag, wo ich irgendwo durch die Strassen gehe, eine Passantin nach einer Kirche frage und sie mir nicht den Weg zum nächsten Glockenturm zeigt, sondern nur meint: «Hier drüben wohnt eine Familie, die an Jesus glaubt und für ihn lebt – da bist du richtig.»
Ein allgegenwärtiges Bild
Natürlich nehmen Menschen Kirche unterschiedlich wahr – je nach ihrer eigenen Prägung: Für die einen muss das Kreuz auf dem Kirchturm stehen, die anderen hängen es in den Gottesdienstraum. Die einen nennen ihre verantwortlichen Personen Pfarrer, die anderen Priester, Prediger, Pastor oder einfach Bruder – trotzdem sind es meist Männer und sie sind für den Gottesdienst zuständig.
Daneben gibt es noch eine ganze Menge Ehrenamtliche, die sich um Organisation, Diakonie, Hauskreise, Kinder oder den Lobpreis kümmern. Rund um ein zentrales Gebäude und den Gottesdienst als Hauptveranstaltung dreht sich ein volles Programm aus diversen Kreisen und Gruppen. Nichts daran ist verkehrt – all das ist nur nicht gleichbedeutend mit Kirche. Es ist vielmehr eine der vielen möglichen Erscheinungsformen davon und manchmal ist es auch gar nicht die Kirche, sondern nur ihr Gebäude.
Ein eklatantes Missverständnis
Ausgehend von den heutigen Strukturen zeichnen Christen gern eine historische Linie von Jesus Christus selbst bis hin vor ihre eigene Kirchentür und sagen je nach Denomination: «So lehrt es die Tradition» oder «Das sagt die Bibel». Dabei liessen die biblischen Vorgaben viel Raum für andere Strukturen als die heutigen. Ein riesiges Missverständnis entstand nach den ersten Jahrhunderten, als die entstehenden Gebäude der frisch gegründeten Staatskirche mit dem gleichen Begriff bezeichnet wurden wie die Menschen, die sich darin trafen.
Die ersten Christinnen und Christen versammelten sich als jüdische Gläubige täglich zu den offiziellen Gebetszeiten im Tempel und den Synagogen (Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1). Dazu trafen sie sich auch in Privathäusern «und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen» (Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 42).
Es gab keinen arbeitsfreien Sonntag, keine eigenen Gebäude und kaum Rituale. Stattdessen war Kirche – die «Ekklesia» – eine Versammlung, eine lebendige Gemeinschaft und eher von gemeinsamen Mahlzeiten und Hilfeleistungen für Bedürftige bestimmt als von christlicher Hierarchie.
Dazu muss man sagen, dass es völlig normal ist, dass die entstehende frühe Kirche eigene Formen entwickelte. Jedes Leben braucht ein gewisses Mass an Organisation. Allerdings haben die heutigen Kirchenmauern damit ein Missverständnis der wachsenden Kirche im wahrsten Sinne «zementiert»: Nicht das Leben darin wird als Kirche wahrgenommen, sondern die Strukturen, Gebäude und Organisationsformen.
Je stärker dies in den Mittelpunkt rückt, desto mehr Handlungsdruck entwickelt sich dadurch: Ein Gebäude muss erst einmal gebaut werden und bindet dadurch Finanzen und Arbeit. Danach will es gefüllt werden, denn die Stühle darin sollten ja nicht leer bleiben. Und im Laufe der Zeit werden diese «Kirchen» zu dem, was eigentlich wichtig ist – sei es die Orgelmusik der traditionellen Kirchen oder die Lobpreiszeit mit Lightshow der hippen Jugendkirche. Dabei besteht Gemeinde aus Menschen, die für Gott und Menschen da sind.
Eine historische Chance
Seit ein paar Jahren verschieben sich in Westeuropa allerdings die Mehrheitsverhältnisse. Schon länger bezeichnet sich der grössere Teil der Deutschen nicht als «gläubige Christen». Seit Frühjahr 2022 gibt es auch «keine kirchlich gebundene Bevölkerungsmehrheit mehr» und das ZDF zitiert den Sozialwissenschaftlter Carsten Frerk: «Es ist eine historische Zäsur, da es im Ganzen gesehen seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr 'normal' ist, Kirchenmitglied zu sein.»
Wer Kirche als «christliches Abendland» versteht, für den bricht eine Welt zusammen. Wer hört, dass die finanzschwächer werdenden Kirchen nun Gebäude verkaufen müssen – vielleicht sogar an muslimische Gemeinschaften –, der bekommt es mit der Angst zu tun. Dass dies zwar realistisch, aber nicht unbedingt bedrohlich ist, darauf weisen zum Glück Autoren wie Alexander Massmann hin.
Was noch fehlt, ist eine neue Aufbruchsstimmung, das neue Denken eines alten Begriffs: Was wäre, wenn Kirche wieder aus Menschen bestünde? Aus Menschen, die sich irgendwo treffen könnten, um gemeinsam zu beten, zu essen, sich zu helfen, füreinander und für Gott da zu sein? Aus Menschen, die nicht einen grossen Teil ihrer Zeit und ihres Geldes dafür verwenden müssten, Machtstrukturen aufrechtzuerhalten und Gebäude zu sanieren. Es stimmt: Das hört sich unscheinbarer an als der Gottesdienst in einem Dom oder einem Stadion, aber irgendwie ein bisschen mehr nach Jesus…
Ist «Kirche» am Ende? So wie bei jedem Gebäude werden irgendwann einmal nur noch Ruinen übrig sein. Ist Kirche am Ende? Nein, denn Jesus ruft immer noch Menschen in seine Nachfolge. Und dann kann es gut sein, dass Kirche ihr grosses Missverständnis überwindet und ich dann irgendwo durch die Strassen gehe, eine Passantin nach einer Kirche frage und sie mir nicht den Weg zum nächsten Glockenturm zeigt, sondern nur meint: «Hier drüben wohnt eine Familie, die an Jesus glaubt und für ihn lebt – da bist du richtig.»
Zum Thema:
EE Schweiz: «Kirche soll wieder Gesellschaft prägen»
Salz und Licht im Quartier: «Wir bringen die Kirche zu den Leuten»
Landeskirchen unter Reformdruck: Plädoyer für eine nachhaltige Kirchenreform
Datum: 15.05.2023
Autor:
Hauke Burgarth
Quelle:
Livenet