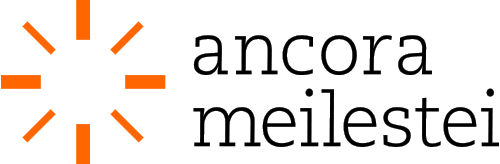Christliche Lebensgemeinschaften als Lebensthema
Was können christliche Lebensgemeinschaften besser als lebendige Gemeinden?
Irene: «Ärger kriegen miteinander!» – Nein, Spass bei Seite: Gemeinschaftlich unterwegs zu sein bedeutet auch, näher miteinander unterwegs zu sein und das Leben im Alltag zu teilen. Das bedeutet, dass sich über kurz oder lange das Sonntags-Gesicht entlarvt: In der Ehrlichkeit liegt die Chance zum persönlichen Wachstum in der Nachfolge Christi und in der Persönlichkeit. Das ist der persönliche und geistliche Nutzen. Projektmässig oder gesellschaftlich gedacht sind die Gesprächs- und Arbeitswege kurz: es stemmt sich einfach und unkompliziert ein gemeinsames Projekt, weil man sich im Alltag begegnet. Und gesellschaftlich gesehen sind Gemeinschaften ein glaubwürdiges Modell gegen die negativen Folgen unseres Individualismus und der damit verbundenen Vereinsamung. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass Ordensschwestern eine höhere Lebenserwartung haben als der «Otto Normalbürger».
Haben diese somit an Attraktivität gewonnen?
Thomas: In unserer gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre auf alle Fälle. Besonders deutlich wurde das während der Corona-Krise. Hier wurde die Vereinsamung auch in den Medien ein Thema. In unserem Gemeinschaftshaus hatten wir dank unserem gemeinsamen Dach viele Begegnungsmöglichkeiten und konnten uns gegenseitig ermutigen und unterstützen.
Der ETH-Ingenieur Pierre Senglet sah vor 30 Jahren in einer Vision, dass christliche Lebensgemeinschaften dereinst wie Pilze aus dem Boden schiessen. Hat sich diese Vision erfüllt?
Thomas: Wer eine Gemeinschaft gründen will, wird schnell erfahren, dass es mit «Aus-dem-Boden-Schiessen» nicht so weit her ist: Der Aufbau einer Gemeinschaft braucht Zeit und viel Herzblut. Dass aber in den letzten 25 Jahren viele Gemeinschaften entstanden sind, seien es kleinere Gruppen in einem grossen Haus oder grosse Gebilde mit zahlreichen Wohneinheiten, das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Die Texte in der Apostelgeschichte über das Leben der Urgemeinde bleiben inspirierend. Gottes Geist bewegt auch heute Menschen, gemeinschaftlich aufzubrechen.
Welches sind die grössten Herausforderungen für (Haus)Gemeinschaften?
Irene: Es müssen einige Dinge zusammenkommen, dass eine Gemeinschaft entstehen kann: Es braucht Wohnraum, Leitungspersonen, Menschen, die mitgehen wollen. Oft sind jene Menschen die ersten, die Gemeinschaft suchen, die diese auch brauchen und sie vielleicht weniger tragen können. Daher ist es immer eine Kunst, genug tragfähige Personen oder genügend tragfähige Fähigkeiten von Menschen in einer Gemeinschaft zu haben. Für die bestehenden Gemeinschaften sind wohl die vielen Anforderungen ein Hauptproblem, die auf die Menschen von heute einprasseln. Da ist der Beruf, die Kinder, die Karriere – und dann noch die Gemeinschaft. Gemeinschaftliches Leben braucht Zeit. Es braucht daher auch den Mut zum Verzicht auf andere Lebensentwürfe. Wird einem dies bewusst, kann es auch sehr befreiend sein, da sich Prioritäten ordnen.
Irene Widmer-Huber, Sie träumen davon, dass christliche Lebensgemeinschaften auch in der Landeskirche Realität werden. Wie könnte das gehen?
Irene: Die Landeskirchen verlieren viele Mitglieder, was auch bedeutet, dass Pfarrstellen gestrichen werden und Infrastruktur frei wird. Die Kirche muss sich in dem Sinne auch neu erfinden. Das allgemeine Priestertum, die aktive Mitarbeit von Laien anstelle von teuren Mitarbeitenden gewinnt ein ganz neues Gewicht, wenn wir in der Landeskirche nicht einfach nur abbauen und an Bedeutung verlieren wollen. Eine Möglichkeit wäre, in den frei werdenden Liegenschaften oder mit dem Bauland neue Wohnmodelle zu ermöglichen und Orte kirchlichen Lebens zu schaffen, wo Christen zum Beispiel ihren Glauben teilen, Gastfreundschaft leben, sich um Mitbewohnende kümmern oder ins jeweilige Quartier hinauswirken mit den Angeboten, die der Gruppe entsprechen.
Wie könnten solche Lebensgemeinschaften in der Praxis funktionieren?
Irene: In der Praxis würden kirchliche Bauten wie Pfarrhäuser oder Kirchgemeindehäuser zu Wohnhäusern mit Gemeinschaftsräumen umgebaut. Die Bewohnenden würden einerseits zusammen leben und sich gegenseitig im Alltag unterstützen und darüber hinaus entsprechend ihren Gaben ins Quartier hinauswirken. Eine Person könnte zum Beispiel an einem Samstag für alle die Kinder hüten, die anderen Mitwohnenden organisieren ein Gartenfest für die Nachbarn, bereiten eine Mahlzeit für Bedürftige vor oder organisieren einen Abend über Glaubensfragen. Was auch immer für die Gruppe am besten stimmt. So entstehen kleine, wendige Zellen des Glaubens mit kurzen «Dienstwegen», die in die Welt hinausstrahlen.
Gibt es Beispiele dazu?
Irene: In einem unserer Riehener Pfarrhäuser lebt eine Gruppe von «Jugend mit einer Mission», die sich für die Region Basel einsetzt. Das wäre so ein Ansatz. Die ersten, die in diese Richtung gehen, sind im Moment die Kommunitäten und Klöster, die ihre freiwerdenden Liegenschaften sinnvoll nutzen wollen. Da entstanden in letzter Zeit ein paar ermutigende Wohnmodelle.
Thomas Widmer-Huber, Sie träumen von einer «Verbindung von Kirche und Gemeinschaften mit kraftvoller Ausstrahlung». Können Sie das erläutern?
Thomas: Ich denke da an Kirchen, die unter ihrem Dach nicht «nur» Kleingruppen haben, sondern auch lebendige Hausgemeinschaften, die in ihren Orts- oder Stadtteil ausstrahlen: Orte der Begegnung und Gemeinschaft, wo Gäste ein- und ausgehen und die dort Wohnenden sich im Gebet und ganz praktisch auch für ihre Nachbarn einbringen. Gemeinschaften sind dann ein sichtbar verlängerter Arm der Kirche.
Sie sagten: «Wir wollen lebendige Gemeinschaft in den Ortskirchen fördern.» Was tun Sie konkret dafür?
Thomas: In Referaten und im Booklet «Gemeinschaft leben» stellen wir attraktive Modelle lebendiger kirchlicher Gemeinschaft vor. Es gibt in der Schweiz viele inspirierende Ortskirchen. Via «Fachstelle Gemeinschaft» bieten wir Beratung an, wie sich Gemeinden punkto Gemeinschaft weiterentwickeln können. Zum einen geht es um neue Impulse für vertiefte Gemeinschaft ohne gemeinsames Wohnen. Zum andern fördern wir durch Beratungen und Seminartage die Gründung von Generationen verbindenden Hausgemeinschaften, die ein neuer Zweig der Gemeindearbeit werden können.
Braucht es diese Unterstützung auch für Freikirchen?
Thomas: Ja, wenn sie sich mehr Gemeinschaft wünschen. Ich denke etwa an die Situation, wo die Mitglieder in mehreren Ortschaften der Region oder in verschiedenen Teilen einer Stadt verstreut leben und neben dem Gottesdienst unter der Woche wenig Gemeinschaft pflegen. Statt sich mit traditionellen Hauskreisen zufrieden zu geben, können Freikirchen sich die Frage stellen: Wo wollen wir in fünf oder zehn Jahren im Blick auf attraktive Gemeinschaftsmodelle stehen? Junge Familien fragen sich: in welchem Umfeld sollen unsere Kinder aufwachsen? Andere überlegen sich mit 60 oder 70, in welcher Lebensform sie alt werden wollen.
Sie sagten kürzlich: «Ein gemeinschaftlicher Lebensstil in den Lokalgemeinden, attraktive Orte christlicher Gemeinschaft und vielfältige Gemeinschaften bergen ein grosses Potenzial für die Zukunft der Kirche.» Sagen Sie etwas mehr über dieses Potential.
Thomas: In Gemeinschaften und in gemeinschaftlich orientierten Kleingruppen wird im Alltag erlebbar, was der Auferstandene verheissen hat: Dort gegenwärtig zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Wenn Christen Freud und Leid teilen und einander im Alltag ganz praktisch zur Seite stehen, stärken sie einander in der Nachfolge Jesu und in der Persönlichkeitsentwicklung.
Darüber hinaus wird für Nachbarn, Freunde und Bekannte spürbar, dass Christen in aller Zerbrechlichkeit einen besonderen Schatz haben. Es werden Zeichen der Liebe und Hoffnung sichtbar. Das weckt Interesse, Menschen werden neugierig. Die Gründung einer neuen Gemeinschaft oder die Bildung einer neuen gemeinschaftlich orientierten Kleingruppe birgt die Chance, dass sich aus dem Miteinander im Alltag eine Dienstgemeinschaft mit Ausstrahlung entwickelt: etwa mit einem diakonischen, quartiermissionarischen, bildenden, künstlerischen oder politischen Schwerpunkt.
Irene und Thomas Widmer-Huber bilden die Co-Leitung der Fachstelle Gemeinschaft (Verein Offene Tür) und des Gemeinschaftshauses Moosrain Riehen. Sie haben den Gemeinschaftstag initiiert und koordinieren ihn.
Zum Thema:
Europäischer «Round Table»: Die neu-monastische Bewegung wächst
In den Golfstaaten: Das Christentum unter Gastarbeitern floriert
Lebensgemeinschaften: Offene Häuser für Jesus
Datum: 24.11.2023
Autor:
Fritz Imhof
Quelle:
Livenet